Termine
23.06.2025
Das Herz der Energiewende
In Deutschland sollen im Jahr 2030 rund 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Damit das funktionieren kann, muss das Stromnetz in großen Teilen ausgebaut und erneuert werden. Für die Industrie bedeutet das zwar volle Auftragsbücher, aber auch große Herausforderungen. Tim Holt, Vorstand von Siemens Energy und Mitglied des ZVEI-Vorstands, blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft.
Heißes Eisen
Das Herz der Energiewende
In Deutschland sollen im Jahr 2030 rund 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Damit das funktionieren kann, muss das Stromnetz in großen Teilen ausgebaut und erneuert werden. Für die Industrie bedeutet das zwar volle Auftragsbücher, aber auch große Herausforderungen. Tim Holt, Vorstand von Siemens Energy und Mitglied des ZVEI-Vorstands, blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft.

In der Nordsee treibt ein kräftiger Wind die Turbinen in den Offshore-Windparks an. Es wird enorm viel Strom erzeugt – und dieser muss über Hochspannungsleitungen dorthin fließen, wo er benötigt wird: In die Ballungsräume im Westen und Süden Deutschlands, wo viele Menschen leben und Fabriken den größten Bedarf haben. Der weite Transport der Energie aus Windkraft ist nur eine von mehreren Aufgaben für Wirtschaft und Politik, die die Energiewende mit sich bringt, sagt Tim Holt. „Bis 2030 sollen etwa 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen“, erklärt der Vorstand von Siemens Energy. „Dafür müssen wir leistungsstarke Übertragungsleitungen ausbauen und neue Transformatoren für die verschiedenen Spannungsebenen installieren.“ Das Netz muss sowohl auf Übertragungs- als auch Verteilnetzebene ertüchtigt werden, um die künftigen volatilen Stromflüsse aus den erneuerbaren Energien verarbeiten sowie die vielen unterschiedlichen Verbraucher wie etwa Speicher, Wärmepumpen, Rechenzentren oder Ladesäulen bedienen zu können. „Und nicht zuletzt brauchen wir Lösungen dafür, wie wir eine stabile Netzfrequenz erzeugen können, für die früher kontinuierlich laufende Kohle- oder Atomkraftwerke gesorgt haben“, sagt Tim Holt, der mit seinem Unternehmen unter anderem Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Systeme (HGÜ) sowie Hochspannungsschaltanlagen und -transformatoren produziert.
Die politischen Ziele sind vorgegeben, die Unternehmen rüsten sich für die Aufgabe. Wie groß diese allein in den Übertragungsnetzen ist, zeigt der Manager an einem Beispiel aus einer Studie der Bergischen Universität Wuppertal, die diese im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und des ZVEI erstellt hat. „Wir müssen rund 35.000 Kilometer Hochspannungsleitungen bauen. Zum Vergleich: Das gesamte deutsche Autobahnnetz ist rund 13.000 Kilometer lang, also etwa ein Drittel davon.“ Auch in die weiteren Bestandteile des Verteilnetzes müssen gewaltige Investitionen getätigt werden. 50 bis 80 Prozent der aktuell verbauten Betriebsmittel müssen erneuert, aufgerüstet oder ersetzt werden, unter anderem eine halbe Million Kilometer Kabel im Niederspannungsbereich sowie rund eine halbe Million Transformatoren, die die Mittel- auf die Niederspannung umspannen.
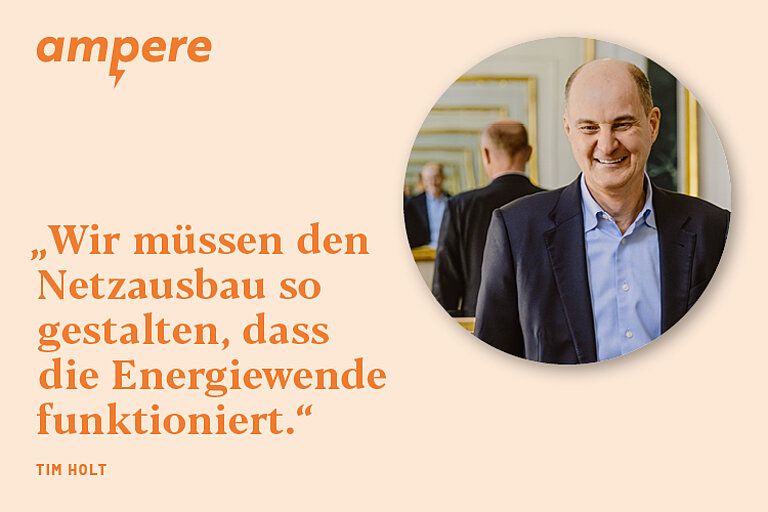
Für die Energiebranche gibt es eine Menge zu tun, auch Siemens Energy stellt das vor Herausforderungen. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren schon rund 4.000 Ingenieurinnen und Ingenieure im Geschäftsbereich Grid Technologies eingestellt, weitere 6.000 sollen bis 2028 folgen. Zudem will der Geschäftsbereich rund 1,1 Milliarden Euro im selben Zeitraum investieren, um bestehende Anlagen zu erweitern und zu optimieren. Ganz einfach ist das nicht, vor allem wegen des Fachkräftemangels. „In Deutschland schließen jährlich rund 8.000 Elektroingenieure ihr Studium ab – und um die konkurrieren unsere Kunden, Wettbewerber und natürlich wir.“ Die offenen Stellen lassen sich auch nicht so einfach mit Ingenieurinnen und Ingenieuren aus dem Ausland füllen, weil zum Beispiel Ausschreibungsunterlagen der Kunden oft auf Deutsch verfasst sind. Aber auch auf Ebene der Facharbeiterinnen und Facharbeiter suchen die Unternehmen mit Hochdruck: „Wir reden hier von komplexen Fertigungsverfahren, für die wir Fachkräfte benötigen“, sagt Tim Holt.
Wenn die Modernisierung des Stromnetzes nicht gelänge, wären die Folgen gravierend: Wind- und Solarparks müssten zu Hochzeiten der gleichzeitigen Stromproduktion abgeschaltet werden, weil der Strom nicht transportiert werden kann. Zudem wäre dann die sichere und stabile Stromversorgung der Verbraucher eingeschränkt. Industrieprojekte könnten ihre Produktion nur verzögert umsetzen, weil sie keinen Netzanschluss haben oder die Netzkapazität fehlt. Im schlimmsten Fall könnten Investoren abwandern, wenn sie woanders schneller an das Netz angeschlossen werden. Weltweit stehen Projekte mit einer Kapazität von 3.000 Gigawatt still, sagt Holt, in England gäbe es Projekte, bei denen Unternehmen sechs, sieben Jahre auf einen Netzanschluss warten würden. Für Deutschland sieht der Diplom-Ingenieur aber zuversichtlich in die Zukunft. Auch wenn die Studie von BDEW und ZVEI die Herausforderungen zeigt: Das inländische Netz steht im internationalen Vergleich gut da. „Die langfristige Planung bis 2045 durch den Netzentwicklungsplan schafft Stabilität und gibt uns die notwendige Sicherheit, um zu investieren“, sagt Tim Holt.
Mehr zur Studie von BDEW und ZVEI zu den Technologiebedarfen in deutschen Verteilnetzen:
Der Manager macht aber auch klar, dass es noch mehr Effizienz und Standardisierung geben muss, um das volle Potenzial der Energiewende auszuschöpfen, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. „Jeder der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat aktuell eigene Spezifikationen, was die Zusammenarbeit erschwert. Von den fast 900 Netzbetreibern auf Verteilnetzebene ganz zu schweigen. Eine einheitliche Vorgehensweise würde den Ausbau beschleunigen und die Kosten senken“, erklärt Tim Holt. Zudem müsse die Netzauslastung mittels Digitalisierung noch stärker in den Fokus gerückt werden. Auch eine stärkere europäische Zusammenarbeit hält er für sinnvoll, zum Beispiel bei der Entwicklung eines gesamteuropäischen Gleichstromnetzes, das erneuerbare Energiequellen effizienter miteinander verbinden könnte. Siemens Energy arbeitet dafür zum Beispiel länderübergreifend unter anderem mit Übertragungsnetzbetreibern, Windkraftanlagenentwicklern und weiteren Windkraftanlagenherstellern sowie Universitäten bei der Initiative Interopera mit, die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Systeme kompatibel und interoperabel gestalten möchte. Für Tim Holt ist eines besonders wichtig: „Wir müssen den Netzausbau so gestalten, dass die Energiewende funktioniert – und auch nicht zu teuer für die privaten und gewerblichen Verbraucher wird.“
Tim Holt ist Vorstand von Siemens Energy. In dem Unternehmen, das entlang der nahezu gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig ist, arbeiten rund 99.000 Mitarbeiter.
Text Marc-Stefan Andres | Bilder Gene Glover
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 2025 am 24. März 2025 erschienen.
